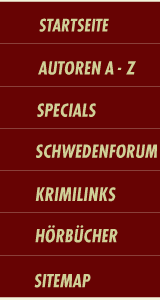Leseprobe
Leseprobe
Fritz merkte, daß ich zu ihm hinschielte, als wir durch
die schmale Tür in eine niedrige Stube traten. Ich fühlte Zorn
in mir aufsteigen. Weniger über die augenblickliche merkwürdige
Geheimniskrämerei als vielmehr darüber, daß mir so lange
Jahre wichtige Aspekte aus dem Leben meiner Familie vorenthalten worden
waren. Daß mein biologischer, unbekannter Vater und meine liebe
und nun an totaler Demenz leidende Mutter ein Doppelleben geführt
hatten, als ob sie Agenten in einem ihnen feindlich gesinnten Land gewesen
wären. Die Stube war klein und auf altmodische Weise gemütlich
mit schweren Möbeln und naturalistischen Gemälden an der Wand.
Rothirsch und wettergebräunter Fischer. Der klassische, kleinbürgerliche
Kitsch, dachte ich in meiner akademischen Arroganz. Als ob meine Plakatkunst
in meinem Zimer an der Uni irgend etwas anderes war als die Widerspiegelung
dessen, was ich und meine Gleichgesinnten nun einmal schön fanden.
Waren wir nicht selber ebenso beschränkt in dem, was wir für
guten Geschmack hielten? Auf einem schweren Regal standen einige Bücher,
meist Kriegs- und Militärgeschichte, wie mir schien. In einer Ecke
stand ein abgenutzter Ledersessel neben einem runden Couchtischchen und
einem dickbäuchigen schwarzen Kaminofen. Auf dem Tisch lagen drei
Bücher, aus denen Lesezeichen herausragten. Die Bücher lagen
dort nicht zur Zier. Dort saß der Herr des Hauses und bildete sich.
Die Stube roch nach Pfeifenrauch und leicht ungelüftetem Altmännerheim,
aber es war eigentlich kein unangenehmer Geruch. Eher etwas muffig wie
Fallobst, ein Duft nach Kindheit, der mir den kleinen bäuerlichen
Betrieb meiner Großeltern ins Gedächtnis rief, wo ich als ganz
kleiner Steppke meine Ferien verbracht hatte. Ich konnte in eine altmodische
Küche schauen, in der eine Dame in Karl Viggo Jensens Alter herumhantierte.
Sie nickte mir kurz zu und wischte ihre Hände an der Schürze
ab, ehe sie in die Stube trat und mir die Hand reichte. Sie war feucht
und kühl, aber der Händedruck war fest, und in ihrem faltigen
Gesicht saßen klare graue Augen.
»Karla Jensen«, sagte sie. »Sie müssen Hunger haben,
nun, wo es keine Fähren mehr gibt, auf denen man einen Happen essen
konnte.«
»Danke für die Einladung«, sagte ich und ließ mich von
der altmodischen Einrichtung und Stimmung gefangennehmen. In Kopenhagen vergaß
man so etwas. Es gab noch ein Leben auf dem Lande, wo Tempo und Tonfall anders
waren. Wo alte Worte und Wendungen existierten, als wäre das Fernsehen
nie erfunden worden.
»Kann das nicht noch eine Viertelstunde warten? Ich würde Irmas Bruder
gern noch das Museum zeigen«, sagte Karl Viggo Jensen.
»Dem steht nichts entgegen«, sagte sie. »Ich habe nur ein
paar belegte Brote gemacht. Die können noch eine Viertelstunde stehen,
aber wenn der Herr nun Hunger hat …«
»Das geht schon«, sagte ich.
»Na, dann lege ich den Schnaps noch mal auf Eis«, sagte sie, als
wäre der Aquavit am wichtigsten und nicht die erstaunlichen Düfte,
die sich im Zimmer verbreiteten, und ging wieder in ihre Küche.
Wir durchquerten ein anderes Zimmer, in dem der Tisch für das Mittagsbrot
gedeckt war, betraten den Garten und steuerten auf ein niedriges, weißgekalktes
Gebäude zu, das früher einmal der Schweinekoben gewesen sein dürfte.
Unsere Füße rutschten auf den glitschigen Blättern der Blutbuche
aus, die noch vom letzten Herbst dort lagen. Karl Viggo Jensen ging voraus,
ich trottete hinterher, und dann kam Fritz, der mit den Füßen schlurfte
und ein wenig schnaufte. Er war nicht mehr jung und hatte sich eigentlich nie
geschont. Hinterließen Zigarre und Pfeife mittlerweile ihre Spuren in
den Lungen meines Bruders? dachte ich und machte mir wirklich Sorgen um ihn.
Die Familie ist doch etwas Seltsames, das einen oft nerven kann, aber es ist
doch das einzig Dauerhafte, was man hat, auch wenn man es sich nicht selber
ausgesucht hat.
| Buchtipp |
 |
Es war ein unheimlicher Raum, den wir betraten, obwohl er mit seinen Wandbildern
und den kleinen Schaukästen mit Ausstellungsgegenständen einem kleinen
Heimatmuseum glich. Das Ausgestellte selbst machte den Raum unheimlich. Es war
ein Gedenkzimmer für die SS mit Fotos von Offizieren in schwarzen Uniformen
und SS-Runen auf dem Kragen, großen Schwarzweißfotos mit Schlachtszenen,
einem Dannebrog mit der Aufschrift »Frikorps Danmark«. Waffen, Orden,
verblaßte Briefe und Papiere, Tagebücher anscheinend, Gasmasken,
militärische Dienstgradabzeichen, Uniformgegenstände, Hundemarken.
Der ganze Scheiß, der auf Schlachtfeldern so übrigbleibt. Karten
von den Schlachten am Ilmensee, bei Stalingrad und Narva waren sorgfältig
in Glasvitrinen ausgebreitet. Mit Pfeilen und kleinen Buchstaben, die die Regimentszugehörigkeit
angaben. Als ob das irgend jemanden interessierte außer denjenigen, der
daran teilgenommen hat. Im übrigen waren sie selbst für einen Historiker
wie mich unverständlich. Es waren läppische Schlachten an einer häßlichen
Front, aber selbstverständlich interessierte die Teilnehmer genau dieser
Frontabschnitt mit seinen kleinen Siegen und Niederlagen. In Wirklichkeit ist
der Krieg für den gewöhnlichen Soldaten eine Frage des nächsten
Grabens und der nächsten Schutzhecke und der nächsten warmen Mahlzeit.
So etwas auszustellen, darauf könnte ein kleines Heimatmuseum mit seinen
begrenzten Mitteln stolz sein, wenn es nur keine Ausstellung war, die den Verlierern
huldigte – und damit dem Bösen. Karl Viggo Jensen sagte nichts, sondern
stand an der Tür, während ich die Runde machte und die Exponate betrachtete.
Fritz stand in der Ecke und starrte nach unten und scharrte mit den Füßen
auf dem sauber gescheuerten Boden. Das ist immer noch ein Schweinestall, dachte
ich, sagte aber nichts. Vielleicht war ich einfach ein wenig ängstlich,
vielleicht wollte ich Fritzens Gefühle nicht verletzen. Manche Bilder kannte
ich sehr gut. Das Freikorps Dänemark auf Heimaturlaub 1942 zum Beispiel.
Der dänische Naziführer Frits Clausen hält eine Rede, war ein
anderes bekanntes Motiv. C.F. von Schalburg mit seinem kleinen Sohn in SS-Uniform
hatte ich auch schon einmal gesehen. Aber eine ganze Reihe anderer Fotos, die
ganz gewöhnliche junge Dänen mit Hakenkreuz und Dannebrog an verschiedenen
Orten der Ostfront zeigten, war neu für mich. Die Historiker hatten sich
mit der Geschichte der Verlierer nicht sehr beschäftigt. Um dieses dunkle
Kapitel der Besatzungszeit zu erforschen, hatte es lange Zeit weder Gelder noch
Stellen gegeben. Aber beim Herumgehen wurde mir klar, daß dies hier kein
nüchternes, wenn auch geheimes Museum war. Es war ein Gedenkraum, der so
sorgfältig gehütet und gepflegt wurde, als wäre die ganze Sache
ein Teil der Jetztzeit und behandelte nicht die bald sechzig Jahre alte Geschichte
der dänischen Landesverräter. Als wenn einige Leute sagen wollten:
Wir existieren. Wir wollen nicht vergessen werden. Wir sind ein Teil von euch.
 |
| Autor
Leif Davidsen |
Auf einem Bild war ein Waffen-SS-Offizier zu sehen, der Karl Viggo Jensen
aufs Haar glich, nur in einer weit jüngeren Ausgabe. Wenn er es wirklich
war, hatte ich mich in seinem Alter vollkommen verschätzt. Er stand
neben einem anderen Mann, den ich als meinen Vater erkannte.
»Ja, das sind ich und dein Vater, Teddy«, sagte Karl Viggo Jensen.
Er war hinter mich getreten, ohne daß ich ihn gehört hatte. Ich starrte
das Bild mit ebenso großer Faszination wie Aversion an. Die beiden jungen
Männer standen in ihren schwarzen Uniformen und mit den schief sitzenden
Schiffchen nebeneinander und trugen ein breites Lächeln auf den Lippen.
Mein Vater hielt eine Maschinenpistole auf Hüfthöhe wie ein Großwildjäger,
der ein wildes Tier erlegt hatte. Aber hinter den beiden Männern lag ein
Haufen Leichen in Reih und Glied wie ausgestellt nach einer Jagd.
»Das waren russische Partisanen. Die hatten einen von uns getötet,
einen Dänen aus Himmerland, und ihm die Augen ausgestochen. Dann rückten
wir in das Dorf ein, und dann bereuten sie ihre Tat. Der Krieg ist eine Schweinerei,
das kann ich dir sagen.«
Ich sagte nichts. Ich spürte zunehmende Übelkeit, je länger ich
mir das Foto mit meinem Vater ansah. Obwohl ich ihn eigentlich nicht gekannt
habe, hatte ich ja seine Gene in mir. Und obwohl ich nicht der Meinung bin,
daß die Sünden der Väter an die Söhne vererbt werden, war
es doch allerhand, mit der Tatsache konfrontiert zu werden, daß der eigene
Vater an Kriegsverbrechen an der Ostfront teilgenommen hatte.
»Dann mußt du ja fast achtzig sein«, sagte ich tumb.
»Achtundsiebzig«, sagte er. »Es sind nicht mehr viele übrig,
und die meisten sitzen als senile Greise im Pflegeheim, aber mir hat Gott eine
kräftige Gesundheit geschenkt.«
»Und wer ist Karl Henrik? Er kann unmöglich dein Sohn sein.«
»Er ist mein Neffe. Er ist der Vereinssekretär, aber davon können
wir dir später noch erzählen. Das hier drüben ist sein Großvater,
komm …« Er zeigte in eine Ecke des Raums, ließ aber meinen
Arm wieder los, als er meinen Gesichtsausdruck sah. Neben zwei Wehrpässen
mit Hakenkreuz waren einige Fotos ausgestellt. Eines zeigte einen Mann, der
eine gewisse Ähnlichkeit mit Karl Viggo Jensen hatte. Er saß mit
einer Pfeife im Mund und einem Gewehr auf den Knien auf einem Panzerwagen.
»Das ist Hans Peter. Das Bild wurde nicht weit von Zagreb in Jugoslawien
aufgenommen, wo das Regiment Nordland 1943 war. Hans Peter kam nicht mehr nach
Hause. Er fiel 1944 bei Narva. Dort liegt er begraben. Wir fanden vor ein paar
Jahren seine Überreste und gaben ihm ein christliches Begräbnis. Die
Esten haben größeres Verständnis für unseren Einsatz gegen
die Roten, als man es hierzulande hat. Und schau dir mal das andere Bild an.«
Auch darauf war mein Vater zu sehen. Er hatte einen nackten Oberkörper
und seifte sich anscheinend gerade ein, bevor er sich unter einer provisorischen
Dusche abspülen wollte, die in einem Baum aufgehängt war. Er sah dünn,
aber doch kräftig aus. Am Bildrand stand eine junge Frau und hielt die
Hände vor die untere Gesichtshälfte, aber man konnte sehen, daß
sie sich vor Lachen über die Späße, die der dänische SS-Mann
auf Lager hatte, gar nicht mehr einkriegte.
Danke an den Zsolnay Verlag für die Veröffentlichungserlaubnis. |